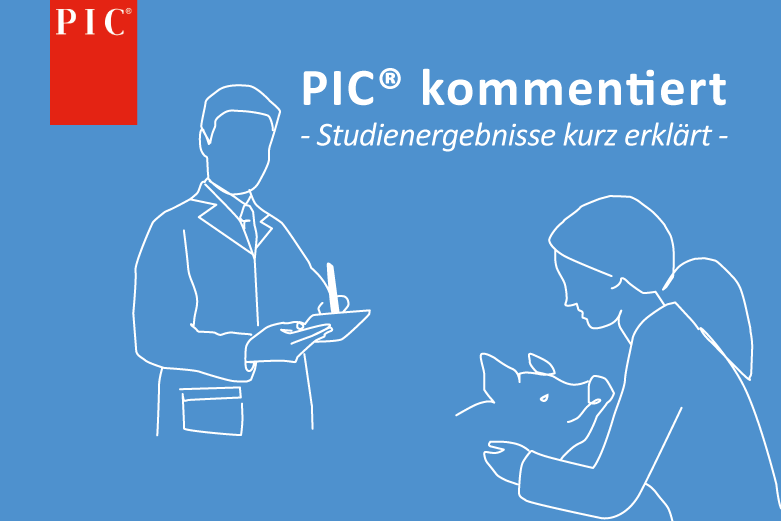Warum das wichtig ist
In der modernen Ferkelproduktion beginnt der Weg zu Nachhaltigkeit, Tierwohl und Rentabilität lange bevor eine Sau ihren ersten Wurf zur Welt bringt. Alles beginnt mit der Auswahl der Jungsauen. Die richtige weibliche Nachzucht in die Zuchtherde aufzunehmen, ist längst nicht mehr nur eine Frage der Reproduktionsleistung – sie ist ein Schlüsselfaktor für langfristige Effizienz, Tierwohl und Stabilität der Herde. Dennoch ist die Auswahl von Jungsauen in vielen Betrieben nach wie vor inkonsequent, überstürzt oder nicht an die Anforderungen des Produktionssystems angepasst.
PIC’s Botschaft ist klar: Mit den richtigen Werkzeugen und Erkenntnissen können Erzeuger leistungsfähigere Herden aufbauen, Verluste reduzieren und das Tierwohl verbessern – beginnend mit der Umsetzung klar definierter Selektionskriterien für Jungsauen.
Was das für Ferkelproduzenten bedeutet
1. Risiken für das Tierwohl und verlorenes Potenzial
Jungsauen mit schlechten Fundamenten oder unausgewogenem Wachstum sind anfälliger für Lahmheiten, Verletzungen und frühzeitige Abgänge. Solche Tiere haben Schwierigkeiten bei der Fortbewegung, der Futteraufnahme und zeigen häufiger problematisches mütterliches Verhalten. Abgesehen vom Tierwohl ist auch die wirtschaftliche Belastung erheblich – jede vorzeitig ausgesonderte Jungsau bedeutet unnötiges Futter, Zeit und genetisches Potenzial.
Beispiel: Lahmende Jungsauen nehmen bis zu 13 % weniger Futter auf. Ihre Entwicklung und die Wurfgröße werden dadurch negativ beeinflusst. Schlecht strukturierte Sauen haben eine höhere Ferkelverluste vor dem Absetzen, verursacht durch Erdrücken, Mastitis oder Entzündungen der Zitzen, die mit Schmerzen beim Stehen oder Liegen zusammenhängen.
2. Effizienz und Langlebigkeit
Gut selektierte Jungsauen erreichen die Zuchtreife mit effizientem Wachstum und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, über mehrere Würfe hinweg produktiv zu bleiben. Im Gegensatz dazu erhöhen schlecht ausgewählte Tiere die Remontierungsrate. Höhere Kosten und eine unausgeglichene Herdenaltersstruktur sind die Folgen.
Datenpunkt: Eine Reduzierung der Remontierungsrate von 55 % auf 40 % kann die Futterverwertung der Herde um bis zu 0,30 Punkte verbessern – mit entsprechend niedrigerem Kostenaufwand je abgesetztem Ferkel.
3. Gesundheit, Robustheit und Biosicherheit
Fehler bei der Auswahl erhöhen die Anfälligkeit für Krankheiten, angeborene Fehlbildungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Jungsauen mit unterentwickelter Vulva, auffälligem Fundament oder abweichender Gliedmaßenstellung haben ein höheres Risiko für Reproduktionsprobleme und mehr Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in die Gruppenhaltung.
Beispiel: Jungsauen, die bereits vor der Geburt Hitzestress ausgesetzt waren, zeigen eingeschränkte Leistungsfähigkeit und eine schlechtere Körperregulation im späteren Leben. Das verdeutlicht die Bedeutung der genetischen wie auch der Umweltfaktoren bereits vor der Geburt.
4. Systemstörung durch eingeschränkte Selektionsmöglichkeiten
Wenn das Angebot an Jungsauen knapp ist, sind Betriebe gezwungen, suboptimale Tiere zu behalten, was die Gesamtleistung der Herde beeinträchtigt. Ein hoher Selektionsspielraum (idealerweise mindestens 10 % des gesamten Sauenbestands) ermöglicht eine strengere Selektion und eine bessere Qualität der eingestallten Tiere.
Beispiel: Durch die Erhöhung des Selektionsspielraums von 6 % auf 10 % kann die Selektionsschärfe bei der Auswahl um 20–30 % gesteigert werden – ohne die Versorgung mit Jungsauen oder die Herdenziele zu gefährden. Dadurch lassen sich die Selektionsstandards besser einhalten.
Wie Innovation die Auswahl von Jungsauen neu definiert
Auch wenn Körperkondition, Zitzen, Form der Vulva und Gliedmaßenstellung weiterhin entscheidend sind, zeigen neue Studien, dass sichtbare Merkmale nur einen Teil des Gesamtbilds ausmachen. Dank des wissenschaftlichen Fortschritts werden heute tiefergehende, vorhersehbare Kriterien einbezogen:
- Digitale Phänotypisierung: KI-gestützte Systeme analysieren objektiv die Gliedmaßenstellung und die Körpersymmetrie.
- Verhaltensmonitoring: Systeme zur Erfassung des Temperaments und der sozialen Anpassungsfähigkeit helfen, ruhigere Jungsauen zu identifizieren – weniger Risiko für aggressives Verhalten oder Ferkelerdrücken.
- Genomische Selektion: Steigert die Vorhersagegenauigkeit um bis zu 30 % – insbesondere bei komplexen Merkmalen wie Langlebigkeit, Robustheit und Reproduktionsleistung.
Ein neues Zeitalter der proaktiven, datengestützten und tierwohlorientierten Selektion hat begonnen.
Neue Technologien: Von der Theorie zur Praxis
Die Definition von Merkmalen und die Art der Datenerhebung verändern sich rasant:
- KI-basierte Körperanalyse verdreifacht die Erblichkeit struktureller Merkmale – für eine konsistentere Selektion.
- Die Integration von Kreuzungsdaten verknüpft die Leistung von Reinzuchttieren mit den Ergebnissen unter Praxisbedingungen.
- Sensoren und Wearables liefern in Echtzeit Informationen zu Bewegung, Futteraufnahme und Stressverhalten – und fließen direkt in genetische Programme ein.
Gemeinsam mit den Schulungsunterlagen der PIC und digitalen Tools für den Einsatz im Stall ermöglichen diese Innovationen eine präzise Umsetzung der Selektionsstandards weltweit.
Fazit: Jungsauenauswahl als Grundlage für Tierwohl und Erfolg
Die Branche steht an einem Wendepunkt. Mit steigenden Anforderungen an das Tierwohl und komplexeren Produktionssystemen steigen auch die Folgen einer mangelhaften Junsauenselektion. Doch mit Hilfe von Wissenschaft, Schulungen und digitalen Innovationen sind Ferkelerzeuger heute besser gerüstet denn je, die passenden Jungsauen – zum richtigen Zeitpunkt und für das richtige System – zu selektieren.
PIC versteht sich nicht nur als Anbieter hochwertiger Genetik, sondern auch als Partner bei der Entwicklung robuster, tierwohlgerechter und leistungsstarker Herden.
Never Stop Improving® beginnt mit der ersten Jungsau.
Quellenverzeichnis
- Calderón Díaz, J.A. et al. (2025). Welfare implications of poor gilt selection standards in commercial pig production systems. Animal Frontiers, 15(2):43–52.
- Patterson, J. & Foxcroft, G. (2019). Gilt management for improved sow lifetime productivity. Animals, 9(7):434.
- Foxcroft, G. (2005). Getting to 30 pigs/sow/year. London Swine Conference Proceedings.
- Smits, R.J. (2011). Impact of the sow on progeny productivity and herd feed efficiency. Recent Advances in Animal Nutrition – Australia.
- Knol, E.F., et al. (2016). Genomic selection in commercial pig breeding. Animal Frontiers, 6(1):15–22.
- PIC (2024). Internal Technical Briefs and Genetic Services Tools.